Hitler. Heißt so noch irgendwer, der lebt?
Das war mal die Ausgangsfrage, vor einigen Jahren. – Gefolgt von: Gibt es noch Adolfs?
Und auf einmal tauchten ein paar auf, in der Öffentlichkeit, umständehalber; bei einem Interviewtermin, berufsbedingt.
Und diese Adolfs waren jung. Nachkriegs-jung.
Neue Frage, also: Wieso heißen sie so? Und – haben sie noch Kontakt zu ihren Eltern? Denn sicherlich, eine andere Erklärung als stramme politische Überzeugung kann ja wohl kaum der Grund sein? Wer hilft seinem Kind qua Name einen solchen historischen Rucksack über?
Und vor allem: Wie lebt es sich mit jenem Vornamen, der so stark ist, dass alle sofort einen kleinen Bart sehen, die schnarrende Stimme im Ohr? Sonst haben Verbrecher schließlich nur Nachnamen. Bei „Josef“ denkt keiner nur an Stalin, bei „Benito“ keiner an Mussolini (Und bei Saddam liegen die Gründe anders). Wie ist es, nicht einfach als Stephan, Andreas, Jürgen, Sabine oder Michael in der Normalo-Masse zu verschwinden – sondern mit dem Bösen per se so persönlich verbunden zu sein, wie es ein Vorname nun mal mit sich bringt?
Wie Namen und Identität zusammenhängen ist in Deutschland wenig erforscht. Die einen konzentrieren sich darauf, inwiefern Namen etwas über unsere gesellschaftliche Position aussagen, allen voran der Soziologe Jürgen Gerhards, der Sachverständigenrat für Migration untersuchte 2014 Diskriminierung am Arbeitsmarkt via Namen, die Onomasten nähern sich eher aus sprachwissenschaftlicher Perspektive, wie die Gesellschaft für Namensforschung oder die Gesellschaft für deutsche Sprache; letztere sind wie auch Knud Bielefeld von Beliebte Vornamen die Ranglistenmacher in dem Feld. (Mehr über Adolfs aus statistischer Sicht? Steht hier.)
„Es gibt einen eklatanten Forschungsmangel, wenn es um den Zusammenhang von Namen und Identität geht“, findet die Philologin Miriam Schmidt-Jüngst, ebenfalls Namensforscherin: “Den Linguisten fehlt die soziologische Perspektive, den Soziologen die sprachwissenschaftliche.”
Bei der Konstruktion von Identität gehe es, so Schmidt-Jüngst, unter anderem um die Frage einer Entscheidung zwischen einer Gruppe oder Abgrenzung: Wie stark identifiziere ich mich mit meiner Familie, also als Teil einer Ahnenreihe? Oder habe ich eher eine individualisierte Ich-Sicht? Wie umzugehen ist mit Vornamen, deren Bedeutung der eigenen Persönlichkeit diametral entgegen stehen, erforscht sie gerade auf anderem Gebiet: anhand der Geschichten von Menschen, die Transgender sind.
„Die einen sagen, Namen sind Labels und für sie nicht wichtig. Die anderen wollen nichts mit dem Namen zu tun haben und versuchen, ihm mit einem Spitznamen zu entkommen. Und andere sind bestrebt, den Namen positiv aufzuladen“, so Schmidt-Jüngst. So belastet „Adolf“ auch sei, „ich kann mir vorstellen, dass man seinen Frieden mit dem Namen macht”.
Wie man via Vorname Teil einer Familientradition wird, wie man sich ein positiv besetztes Vorbild sucht, um die belastenden Assoziationen zu ersetzen – und wie Familien an „Adolf“ zu zerbrechen drohen: All diese Facetten bündelt übrigens ein französischer Film von 2012, basierend auf einer Theaterkomödie. Er heißt im Original schön abstrakt „Le Prénom“, Patrick Bruel spielt auch mit, ein großartiges Kammerstück:
Wer noch eine positiv besetzte Alternative sucht – in dieser Story taucht eine auf: Adolphe von Benjamin Constant. Ein Liebesroman von 1816.
P.S.: Falls sich jemand über das Neonpink auf der Startseite wundert: weiter weg von handelsüblichen Adolf-Assoziationen ging nicht.


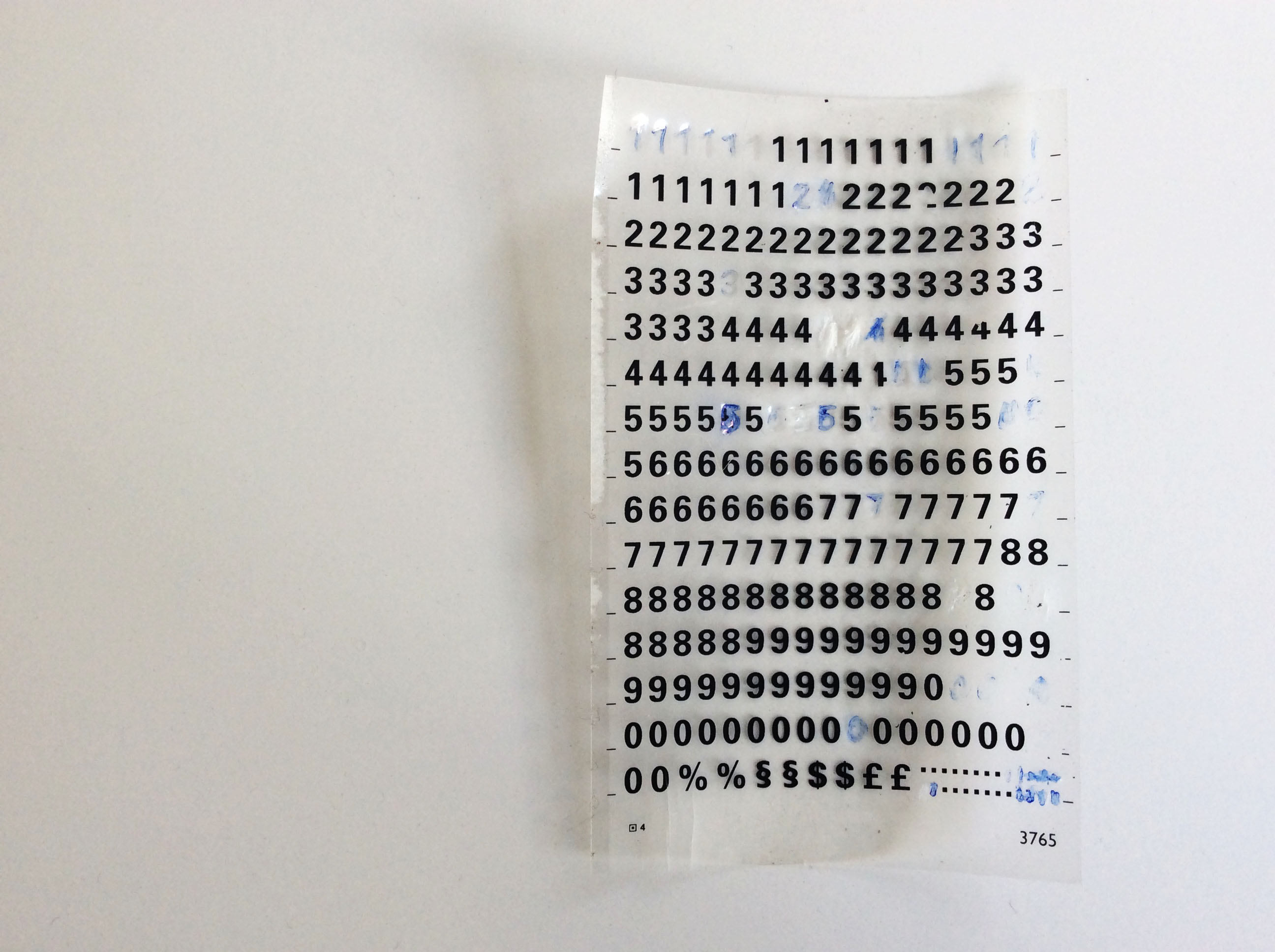


Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.